Taschenbuch
76 Seiten
2015
2. Auflage 2017
ISBN 978-3-944503-08-0
Bernd Volkert
immer noch nicht hell
Gedichte
Ob es einmal Zeiten gab, in denen es nicht Traurigkeit war,
die Menschen schön machte?
Über den Autor
Bernd Volkert wuchs in Lehenhammer bei Sulzbach-Rosenberg in der Gastronomie auf, wo er, nach Jahren des Empfangs von Lohn-, Staats- und Gewerkschaftsgeldern, mittlerweile wieder gelandet ist, allerdings in Berlin.
Vom Autor außerdem erschienen:
Der amerikanische Neokonservatismus. Entstehung – Ideen – Intentionen, LIT Verlag, Münster 2006
Rezensionen
»Dass in der Lyrik Sprache so sich verhält, dass sie auf Versöhnung weist, dass ihre Elemente selbst im freien Spiel zu gegenseitigen Nutzen und Wohlgefallen sich sind und, streng materialistisch, als das Musikalische der Sprache sich durch den Gehörgang bahnt, um verschämt aber unverzagt auf das zu weisen, was eine harmonische Ordnung sein könnte; all das klingt in den schön gebauten Versen Volkerts an. Mit der Austreibung der Naivität aus der Lyrik ist es Volkert ernst, die Gedichte haben nicht die scheinbar unmittelbare Macht der Natur, des Außermenschlichen, zum Thema, alles ist ins Soziale, in die Liebe, die Sprache und den Dialog, gesetzt.«
– Jakob Hayner
Ann Cotten in kolik. Zeitschrift für Literatur, Nr. 75 (2018):
So wie es Outsider-Art gibt, gibt es auch Outsider-Literatur. Bloß dass die Literatur an sich schon, auf eine Art, Feld von Outsidertum ist (nicht zufällig stellen Frauen, die geborenen Outsider, die Mehrzahl der Lesernnnie*) – ausgeschlachtet von einem kleinen, unfeinen Mainstream. Dann gibt es noch die Avantgarde und die »schwierige« Poesie – und dann gibt es Formen, die in diese Kulturen, die sich durch größere Strenge vom Mainstream abseits Belletristik abgrenzen, auch nicht hineinpassen. Man wundert sich ein bisschen, dass das geht, Outsider von den Outsidern zu sein, aber es ist eigentlich sehr deutlich. Eine lustige Gruppe von Outsider-Literatur besteht aus den Popstars, Politikern etc., die in die Literatur gehen. Ob mit Ghostwriter oder mit Songtexten. Sie bringen einen anderen Wertekanon mit, in dem sie bereits (meist) erfolgreich sind, und der schlägt sich ein wenig mit den Werten der in sich ruhenden reinen Literatur.
Schlage die gesammelten Gedichte von Nick Cave, Patti Smith, Leonard Cohen oder den Stones auf. Man kommt auf die Idee, ihren Mut zu bewundern, den Mut zum Kitsch und zum Klartext – weil ein Songtext ja auch anders funktioniert als geschriebene Lyrik. Du wirkst beim Songtexten eher peinlich, wenn du zu viel dich abzusichern versuchst mit den bei geschriebener Literatur so hoch im Kurs stehenden Techniken wie Selbstreflexivität, Ironie, Komplexität.
Die Autobiografien und Biografien von Menschen, die jenseits der Literatur bedeutend erscheinen, müssen sich ebenfalls zwischen den Werten der beiden Bereiche orientieren und treffen dabei oft interessante und ungewöhnliche Entscheidungen. Auch hier gibt es Gelegenheit zum Cringing, aber auch zur Entspannung der doch auf einen lächerlich engen Bereich fixierten Wertvorstellungen der Literatur. Da schreibt David Byrne quasi Kolumnen übers Fahrradfahren, Art Garfunkel über seine Fußmärsche, Karl-Heinz Grasser Pilgerberichte, Claire Goll intimen Klatsch, während Anwälte und Psychoanalytiker uns mit den schrägsten Anekdoten aus ihrem Berufsleben unterhalten, wie Ferdinand von Schirach oder Oliver Sacks, und jetzt lese ich gerade die Autobiografie eines Radioteleskopisten, der sein Leben der Suche nach intelligentem Leben im All gewidmet hat. Die Grenze zu Romanen, wo die autobiografische Komponente eine diskret zu behandelnde Unbekannte bleibt, wie etwa Serhij Zhadans »Die Erfindung des Jazz im Donbass«, ist fließend. Es ist ein weiter Bereich und trifft sich mit so etwas wie dem Weichbild der Literaturbenutzernnnie, die parallel zu den nicht im strengen Sinn literarischen Gründen zu publizieren ihrerseits auch eher aus nichtliterarischen Gründen lesen. Die sind miteinander gut beschäftigt.
Ein ganz spezifischer Fall ist die Literatur, die im engeren Feld oder sagen wir vielleicht soziologisch akkurater in der Community der literarisch guten Literatur ihren Platz findet, aber irgendwie deutlich von woanders kommt. Eigentlich speist sich diese Community über die Jahrzehnte natürlich nur von solchen Leuten, jeder kommt woandersher, aber die meisten haben wache Assimilationsinstinkte. Im ersten Kontaktjahr lernt man etwa, dass Apostrophe bei Zusammenfügungen wie »mein’s« einen Gedichtband schlagartig in ein ungeschicktes, hinterwäldlerisches Licht rücken. Solche Einordnungen sind schwer zu schlucken, wirkt die modische Verurteilung doch ziemlich arbiträr. Ebenso hätte es so kommen können, dass Leute, die weiterhin Substantiva großschreiben oder Serifen verwenden, wie Deutschlehrernnnie aus der Provinz wirken. So passiert es, dass nicht nur aus Unschuld solche Apostrophe stehen bleiben, sondern auch aus Sturheit bzw. der Überzeugung, es werde sich auf Dauer als souveräner erweisen, immer über der Mode gestanden zu haben. Ähnlich läuft es mit anderen, weniger leicht zu fassenden Werten. Jedre hat ja schon ein mal geliebt den hohen Ton der Schwärmernnnie (weibliche Schreibende nutzten dabei, um den Terror der damaligen für Frauen sehr gefährlichen Rufschädigungskultur zu umgehen, häufig die Klamotte der religiösen Dichtung) in chauvinistischen patriarchalen Gesellschaften. Und ihn emuliert und dabei ähnliche Schönheiten produziert. Und dann kommen Lesernnnie und suchen nach der Grenze des Zulässigen oder Achtbaren. Ab wo muss man sagen, dass sich dier Autorni in seihrner Schwärmerei für die vergangenen Töne zu sehr gehen lässt, wo kann man ihrm vorwerfen, sier hätte wenigstens mit der Hälfte der Substanz etwas tun müssen, das zeigt, dass sier die kontemporäre Gesellschaft auch ernst nimmt? Da könnte sier leicht die Entscheidung treffen, als Outsider, zu denken, da leben wir doch alle drin, das muss man doch nicht extra dazusagen.
Die Lyrik im Besonderen hat etwas von Drag, manchmal. Auch insofern dieser wiederum was mit Poetry-Slam und 5 Minuten Ruhm zu tun hat: Du ziehst dir diese Klamotte, diesen Gedanken an und schaust, wie sich darin deine Bewegungen machen. Oder machst Bewegungen nach und siehst dein Material durch sie neu. Kleine Studien.
Vielleicht bringt ein Gedicht aus Bernd Volkerts Gedichtband »Immer noch nicht hell« auf den Punkt, was der Vorwurf ist, den man ihm machen kann:
IF ONLY, IF ONLY, IF ONLY . . .
If anything I dreamed to do
had been similar to the world I knew
I had not drunken that amount
one day for sure
had started to count
Falsches Englisch wurde nach meiner Kenntnis in der Literatur nur von Ernst Jandl jemals so exquisit eingesetzt. Love.
Bernd Volkert ist der Kneipier vom Laidak in Berlin-Neukölln, und schon lange Zeit vorher war er der Mittelpunkt eines linken bayrischen Salons in Friedrichshain, wo man sich zum Konsum von Avantgardefilmen (ich habe einst Lars von Triers »Hospital der Geister« dort gesehen), Literatur und Spargel traf. Die Liebe zur Literatur, zu guter Musik und anderen Medien ist die Luft, die er atmet. Er macht keine Kompromisse. Er ist mutig und herzlich, in Freundschaft, Liebe und beim Schreiben. Und vielleicht gibt es in Bayern, wie in manch einer anderen deutschen Provinzgegend, eine besondere anarchistische Tradition, in der sozusagen Fraktur nicht mit faschistischer Dumpfheit gleichgesetzt wird, wo eine Kontinuität von Traditionen des Untergrunds aus dem 16. Jahrhundert herauf nicht nur denkbar erscheint, sondern ein geradezu unwiderstehlich kitzliger Gedanke ist gegenüber der enttäuschten / enttäuschenden Modeme. Und so spielt man damit wie mit einem Kreisel am Tisch.
SCHWER IST LEICHT WAS
Nur nicht ganz beliebig
Wörter finden, die sich reimen, sondern ganz umtriebig
sinnend suchen nach den Reimen, die mir und euch die Welt erklären und keine Fragen offen lassen
nach diesen oder andern Sphären, sondern eins in alles fassen.
Doch find ich keine solchen Reime, muss auf Lösungen verzichten, erstickt des Dichters Drang im Keime oder äußert sich in Spaßgedichten.
So, jetzt kommt man schon eher drauf, was ich meine, oder? Wie eine Jongliernummer, die damit anfängt, dass man glaubt, sie scheitert, jedoch wird der Teller knapp vor dem Boden aufgefangen und die ganze Scheiterei erscheint als Trompe-l’œil – war aber länger als die rettende Pointe . . . ein Clown, dessen Weinen echt ist, wie aber auch die weiße Schminke wahrer seine Seele zu zeigen scheint als irgendwelche angeborenen körperlichen Merkmale.
Die einzelnen Gedichte Volkerts sind in ihrer Nachdenklichkeit und Heterogenität wie Kunstobjekte, bei denen sich nur einzeln die Frage stellt, warum die ziemlich bewusst wirkende Wahl der Mittel gerade so ausgefallen ist. Sie haben darin eine Tranzparenz, die zum Diskurs einlädt, das ist vermutlich, soweit ich seine Bekanntschaft machen durfte, auch eine Qualität des Autors und seiner Kneipe, die immer voll mit Literaten, literarischen Veranstaltungen und politischen Vorträgen ist.
Es schreibt jemand, der vielleicht zu viel von der Literatur erwartet. Das ist aber rechtens. Wie sonst? Es schreibt jemand, der auch die Klassiker ernst nimmt, nicht nur »vom Inhalt her«, sondern auch sprachlich, was sich logischerweise darin ausdrückt, dass man solche Mittel auch selbst einsetzt. Ich kenne das auch von mir und vom geliebten Vorbild Peter Hacks, und wir sind alle in Gefahr, dadurch eklektisch oder einfach wie jemand zu wirken, der in Flohmarktkleidung durch die Stadt läuft. Love.
(* Polnisches Gendering: alle für alle Geschlechter benötigten Buchstaben in beliebiger Reihenfolge ans Wortende.)
»Dem Dilemma der begrenzten Lebenszeit, der Kostbarkeit des Augenblicks, stellen sich nur einige Aufrechte, sie werden Dichter oder Trinker, meistens beides. Bernd Volkerts erster Gedichtband ›immer noch nicht hell‹ ist das Ergebnis genauer und geruhsamer Beobachtungen dieses Phänomens.
Aufgewachsen in einem unbedeutenden Nest der bayrischen Oberpfalz hatte er viele Gelegenheiten, alle Nichtigkeiten geordneter und verzweifelter Lebensentwürfe aus der Nähe zu betrachten. Seine Eltern betrieben die größte Gastwirtschaft des Ortes, er betreibt mittlerweile ein Lokal für Desperate in Berlin-Neukölln. Zwischendurch hatte er eine eigene Abteilung des bayrischen Verfassungsschutzes an der Hacke, wurde für die größte Straßenschlacht Nürnbergs verantwortlich gemacht und versuchte den Spagat, in sogenannten linken Strukturen Genießer zu bleiben.
Die erstaunlichen Momente der Ruhe eines bayrischen Dickschädels lassen sich erst beim zweiten Lesen auskosten, dann aber schneidet man sie erstaunt in Scheiben und kaut mit überraschendem Abgang. Ein gut gelagerter Jahrgang, der seine Frische gut prickeln läßt.«
– Richard Rixdorfer, junge Welt

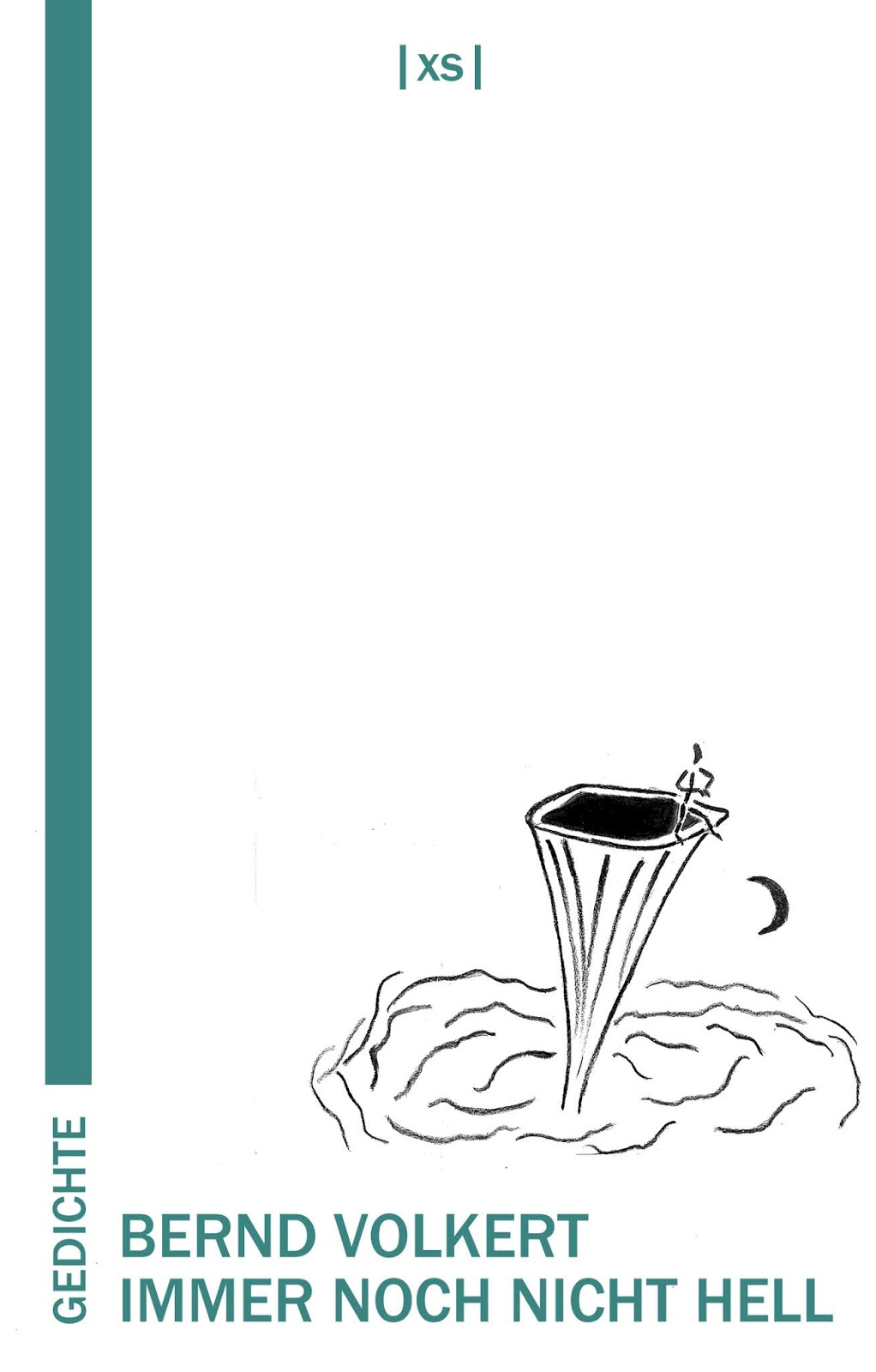
 © XS-Verlag
© XS-Verlag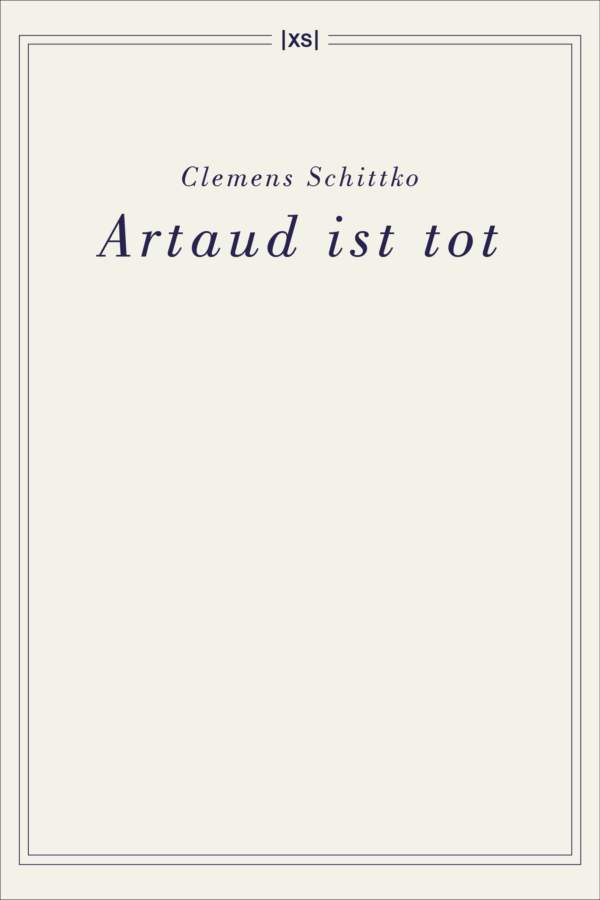 XS-Verlag
XS-Verlag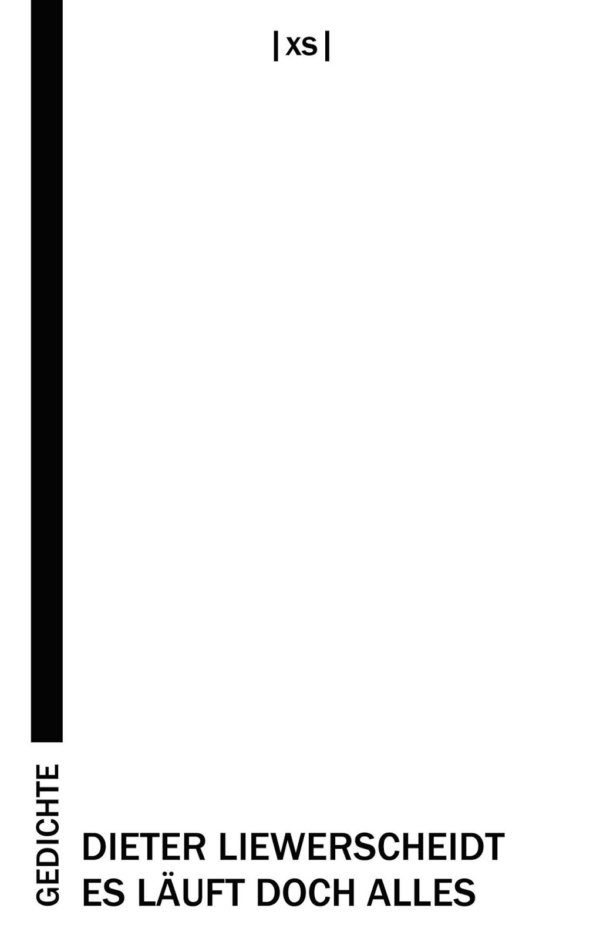 XS-Verlag
XS-Verlag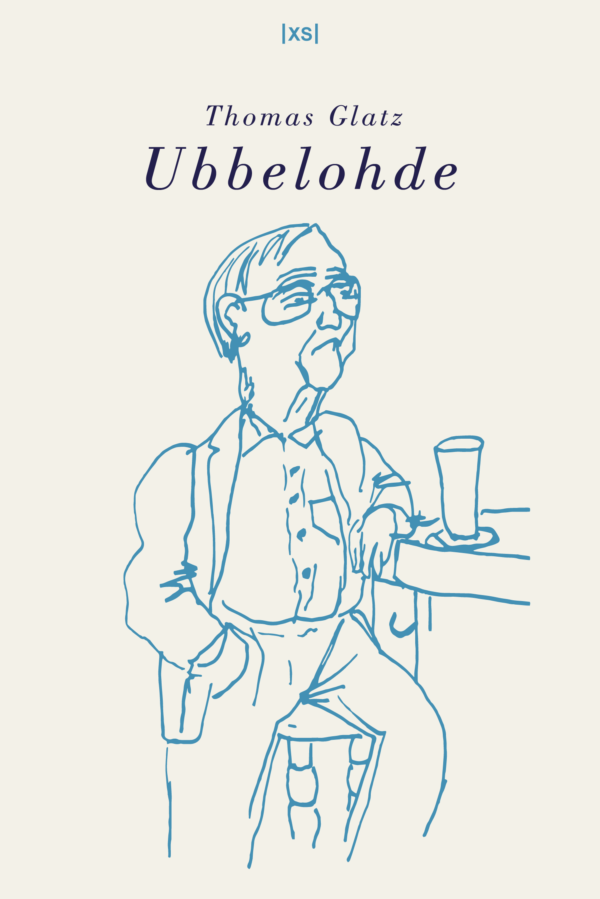 XS-Verlag, Design: Jenny Dam
XS-Verlag, Design: Jenny Dam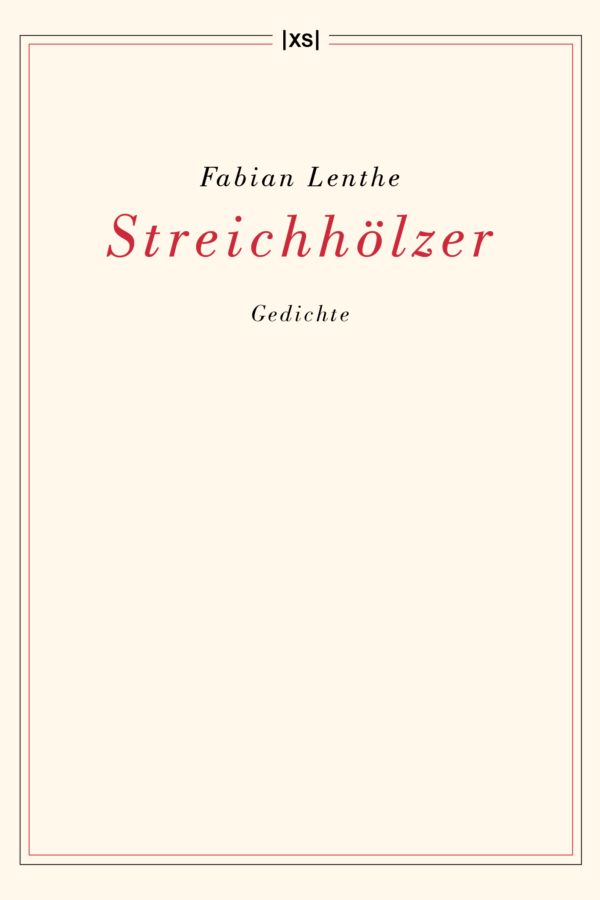 XS-Verlag
XS-Verlag XS-Verlag
XS-Verlag XS-Verlag
XS-Verlag